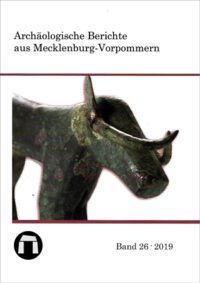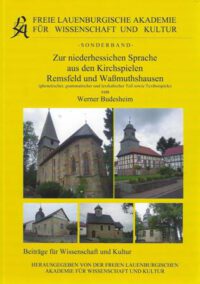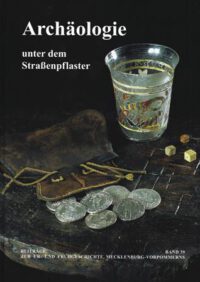> In der Publikationsfolge „Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland“ werden nunmehr als Teil IV Spezialuntersuchungen veröffentlicht. Breiten Raum nimmt die Darstellung des Silberschatzes ein. Der Schatz war unter dem Fußboden des Hauses 157/16 der Siedlung B verborgen worden. Er wiegt 2750 g und umfasst 2211 identifizierbare Münzen bzw. Münzbruchstücke, weitere Münzreste, die als kleine Hacksilber-Bruchstücke nicht bestimmbar waren, sowie das Bruchstück einer Armspirale vom Permer Typ. Der Silberschatz war seit seiner Thesaurierung vor oder um 850 nicht wieder angerührt worden.
Inhaltsverzeichnis:
Joachim Herrmann
• Vorbemerkungen
Der Silberschatz von Ralswiek – niederlegt vor 850
Joachim Herrmann
• Zu den Fundumständen und zur Fundanalyse des Silberschatzes von Ralswiek
Jarmila Štěpková
• Katalog zum Münzschatz von Ralswiek
Tafeln 1–20 mit ausgewählten Münzen
Aleksej V. Fomin
• Überblick und überregionaler Zusammenhang des Münzschatzes von Ralswiek – Originäre Münzstätten und chasarische Nachprägungen
Naturwissenschaftliche Untersuchungen
Hans-Joachim Bautsch
• Petrographische Untersuchungen von Fundstücken aus Gesteinsmaterial der Grabung Ralswiek
Hans-Joachim Bautsch
• Mineralogisch-technische Untersuchungen an frühmittelalterlichen Perlen der Grabung Ralswiek
Jerzy Piaskowski
• Die Eisentechnologie im frühmittelalterlichen Ralswiek – Metallkundliche Analysen
Norbert Benecke
• Haustierhaltung, Jagd und Fischfang im frühmittelalterlichen Ralswiek – Die archäozoologischen Untersuchungen an den Tierresten von der Hauptsiedlung
Versuch einer Forschungsbilanz
Joachim Herrmann
• Ralswiek auf Rügen. Seehandelsplatz und Transitstation seit der 2. Hälfte des 8. Jhs. – Versuch einer Forschungsbilanz

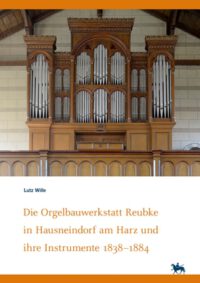 Band 6: Die Orgelbauwerkstatt Reubke in Hausneindorf am Harz und ihre Instrumente 1838–1884
Band 6: Die Orgelbauwerkstatt Reubke in Hausneindorf am Harz und ihre Instrumente 1838–1884  Band 5: Frühe Denkmaldokumentation und Reiseskizzen. Die Zeichnungen des Stadtbaumeisters Wilhelm Ludwig August Stapel (1801-1871) in der Marienbibliothek zu Halle (Saale)
Band 5: Frühe Denkmaldokumentation und Reiseskizzen. Die Zeichnungen des Stadtbaumeisters Wilhelm Ludwig August Stapel (1801-1871) in der Marienbibliothek zu Halle (Saale) 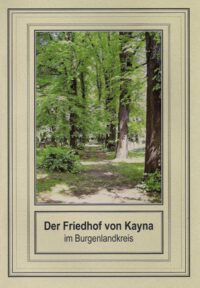 Komplettpaket: Kleiner Sakraler Kunstführer
Komplettpaket: Kleiner Sakraler Kunstführer 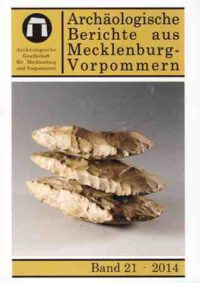 ABM Heft 21 (2014)
ABM Heft 21 (2014)